XXXIV.
Maria Caecilia Alexia II. Schaalin
Maria Caecilia Alexia II. Schaalin von Fryburg im Breisgau wurde den 1. September 1721 canonice erwöhlt. Sie hat wehrend ihrer 31 jährigen sehr lobwürdigen regierung die Abbtey theils repariert, theils von grund aus, wie auch das ganze Dorment erbauet und sonsten durch ihre kluge regierung mit einem worth dem Gottshaus sehr vil nuzliches verschaffet. Nachdem sie sich in den Göttlichen willen vollkomnest resigniret, ist dise den 21. Merz 1752 zu ihrem Gespons und himlischen Breitigam abgefahren..
Quelle: Die Pforte 12. & 13. Jahrgang, Nr. 22 bis 25 – 1992/93, S. 50
Stift Wonnentals letzte Jahre und Ende
von Dr. Engelbert Krebs
II. Maria Caecilia Alexa Schaal
(1721 – 1752)
Zur Nachfolgerin der Frau Beatrix wurde am 1. September 1721 die tatkräftige, 37jährige Freiburgerin Maria Caecilia Alexa Schaal gewählt, welche, seit ihrem 23. Lebensjahr Profeßfrau des Klosters, es bis auf 45 Profeßjahre und 31 Jahre der Regierung brachte. Maria Caecilia, mit ihrem weltlichen Namen Maria Magdalena genannt, war die Tochter des Freiburger Schreiners Christoph Schaal und der Kunigund Fingerlin, geboren als das vierte von 14 Kindern am 26. Dezember 1684. Sie war die Schwester des im beginnenden 18. Jahrhundert hier wohnhaften Buchdruckers und Verlegers Xaver Schaal, welcher der Stammvater der heute noch in Freiburg und Todtnau blühenden Familie Schaal ist, sowie durch weibliche Linie auch derjenige der Familie des Verfassers dieser Zeilen. Das Totenbuch rühmt von ihr unterm 21. März 1752: sie habe „in Zeit ihrer Regierung das alte Gebäu abbrechen und in die vier Eck das Kloster wieder neuer dinge, aus dem Fundament mit sondern großen Sorg – Mühe – Fleiß – und Unkösten auferbauen lassen, wie auch die neue Scheuern und die Stallung im Langbau“. Die eingangs erwähnte Kenzinger Gedenktafel präzisiert diese Angaben etwas genauer dahin, daß sie einiges repariert, anderes von Grund auf neu errichtet, so z. B. das ganze Dorment. Die Kirche wird nicht eigens erwähnt, wird also wohl auch nur gründlich repariert worden sein. Jedenfalls blieben die alten mittelalterlichen Grabsteine in ihr erhalten und existieren noch, wie wir später sehen werden.
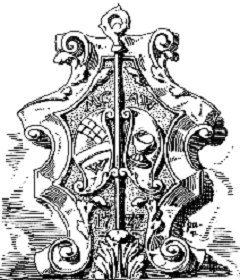
Legende: M(aria) C(aecilia) A(batissa) W(onnenthal) 1727.
Quelle: Breisgau-Verein Schau-ins-Land 39. Jahrlauf 1912, S. 42
Das Wappen der Frau Äbtissin Schaal findet sich heute noch in dem Türsturz der Abtei, welche Lederle im 7. Band unserer Zeitschrift (S. 54) abgebildet hat. Es trägt die Jahreszahl 1727, ist zweischildig und zeigt links oben das Schachbrett der Zisterzienser, darunter das lateinische W (Wonnental), rechts ihr persönliches Wappen, die goldene Trinkschale. Was die Äbtissin aus dem verwüsteten Kloster durch diese Bautätigkeit gemacht hat, zeigt unser Bild Seite 43, das wir der Nachfolgerin der Frau Schaal, Äbtissin Katharina von Storp verdanken, deren Wappenschild darüber schwebt.
Sehen wir uns das Bildchen kurz an. In behaglicher Breite liegt das im Viereck gebaute Kloster, umgeben von Wirtschaftshof, Nebengebäuden, Gärten, Wiesen, Teich und Pfuhl in der Ebene südöstlich von Kenzingen.
An der Hand der Beschreibung aus dem Jahre 1806 (GL.) ist es möglich, die einzelnen Gebäulichkeiten festzustellen. Wir sehen zunächst vor uns den 175 Schuh (52,5 Meter) langen, nach Osten blickenden dreistöckigen Konventflügel, mit 35 Zimmern. Daran schließt sich links, nach Süden blickend, der 119 Schuh (35,7 Meter) lange dreistöckige Noviziarsflügel mit 26 Zimmern. Dem Beschauer gerade gegenüber nach Westen blickend liegt der sogenannte alte Bau, 140 Schuh (42 Meter) lang, zweistöckig, unten Küche und Kammern, oben 6 Zimmern enthaltend. Nach dem Hofe zu öffnet sich dieser Bau in einem offenen Kreuzgang, in welchen der Blick des Beschauers gerade hineinfällt. Der nördliche Flügel wird gebildet von der Abtei, dreistöckig, 96 Schuh (28,8 Meter) lang und 17 Zimmer nebst 2 Kellern enthaltend, und der Kirche. Diese war 105 Schuh (31,5 Meter) lang und ragte deshalb mit ihrem Chor über das nordöstliche Eck ein gutes Stück hervor.
Rechts vom Kloster liegt am Teich mit eigenem Gärtchen das kleine Haus des Beichtvater, welches im 18. Band unserer Zeitschrift (Seite 8) abgebildet ist. Weiter rechts, an Gemüsegarten, Teich und Wirtschaftshof anstoßend, die Metzig mit dem Holzremis. Den Hintergrund nimmt die lange Scheuer mit Wagenschopf, Pferde-, Rindvieh- und Schweineställen ein, woran sich rechts am Eingang das zweistöckige Schaffneihaus und einige kleine Tagwerkerhäuschen anschließen.
Die innere Ausstattung war nach dem im Sommer 1805 aufgenommenen Inventar (GL.) keine sehr reichliche. Auffallend ist der gänzliche Mangel einer Bibliothek. Dagegen enthielt das Kloster eine hübsche kleine Apotheke, welche beim Verkauf merkwürdigerweise keinen Liebhaber finden konnte, obwohl man sie nur mit 80 fl. anschlug. In der Kirche standen drei neue marmorierte und vergoldetet Kopfaltäre und eine gute Orgel, auf dem Turm hingen zwei Glocken, auf denen die Turmuhr Halb- und Viertelstunden schlug. Der Kirchenschatz war sehr gering: 2 Monstranzen, 2 Kelche, 2 Ziborien, 4 Paar Meßkännchen, ein silberner Stab für die Äbtissin, 31 Meßgewänder und 8 Pluvialia, ein hl. Leib in Pretiosen gefaßt und 26 alte Grabsteine aus dem Mittelalter bedeuteten das Wertvollste, was die Kirche an irdischem Gut besaß.
Die Zellen der Frauen waren aufs einfachste mit Bettstatt, Fußtrog, Stuhl, Kleiderkasten, kleinem Tisch, und „Handbeckenkästchen“ ausgestattet; selbst das Wohnzimmer der Frau Äbtissin muß für die Gewohnheiten der Klöster des 18. Jahrhunderts auffallend einfach, ja ärmlich ausgesehen haben. Enthielt es doch, außer den nötigen Stühlen nur einen Hartholztisch, einen niederen Kasten, zwei „Wichstuchtischchen“ und ein ebensolches mit Aufsatz. Die einzigen reicher möbilierten Räume waren die für den Empfang vornehmer Gäste bestimmten Prälatenzimmer mit gesticktem Lehnstuhl, gepolsterten Sesseln und anderen Bequemlichkeiten. Immerhin kam auch hier die ganze Einrichtung des vornehmsten Zimmers im Werte auf nur 28 Gulden amtlichen Anschlags vom Jahre 1806. An Kunstwerken war nicht viel im Hause: ein Bild der hl. Familie, eine Himmelfahrt Mariens, ein heiliger Benedikt und Bernhard, ein Ecce Homo und das Porträt des Kaisers Leopold II. Dazu hingen in den Gängen und Zimmern kleine Täfelchen und Kupferstiche, und dazwischen, an ehrenvollem Platze die Tafel mit den Wappenschildern sämtlicher Äbtissinnen, welche im 20. Band dieser Zeitschrift veröffentlicht ist.
Einige wertvolle Holzschnitzereien aus dem Mittelalter, welche jetzt in Kenzinger Privatbesitz sind und aus dem Kloster stammen sollen, sind wahrscheinlich im 18. Jahrhundert aus Geschmacksrücksichten auf den Speicher gewandert. Ich gebe die zum Teil vorzüglichen Werke in Abbildungen im zweiten Teile dieses Aufsatzes.
Neben dem Kloster stand dann, wie schon erwähnt, das kleine Häuschen des Beichtvaters, dessen Einrichtung aus zwei Tischen, einem Stehpult, Kästchen mit Aufsatz, einem großen Kasten, fünf Sesseln, einem grünen Fauteuil und einem Taburett bestand. Eine große gepolsterte und gefederte Galakutsche, 5 Pferde, 16 Stück Rindvieh, 24 Schweine und ca. 60 Stück Federvieh füllten noch die Stallungen.
Quelle: Breisgau-Verein Schau-ins-Land 39. Jahrlauf 1912, S. 41
Die Abkürzungen der Quellen bei Krebs bedeuten:
(K.) =Papiere der letzten Äbtissin im Besitz der Familie Krebs
(M.)= Mortuarium des Klosters Wonnental im selben Besitz
(L.)= Archiv des Klosters Lichtental, Acta Wonnentaler Frauen betreffend Nr. 29
(GL.)= General- Landesarchiv, Kloster Wonnental, Aus Kenzingen Convolut 31 und 32 Wonnental betreffend
(E.)= Erzbischöfliches Ordinariatsarchiv


